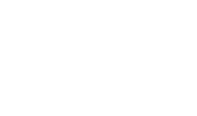Kera'a
Aktueller Status des Kera'a
Kera'a ist eine transhimalajische Sprache, die in der Provinz Arunachal Pradesh im Nordosten Indiens entlang der chinesisch-indischen Grenze gesprochen wird. Die Zahl der Sprecher wird auf 10.000 bis 16.000 Menschen geschätzt. Kera'a ist durch mehrere Faktoren vom Aussterben bedroht. So ist Kera'a beispielsweise nicht als offizielle Sprache anerkannt. Zudem werden Grundschulkinder nur auf Hindi und Englisch unterrichtet, was die Weitergabe der Sprache von der älteren an die jüngere Generation erschwert. Es gibt darüber hinaus nur wenig schriftliches Material in Kera'a, und obwohl die Menschen versucht haben, die Sprache schriftlich darzustellen, gibt es kein offiziell anerkanntes Schriftsystem. Infolge der Globalisierung müssen sich die Kera'a an diverse andere Bevölkerungsgruppen anpassen, wodurch die Gelegenheiten, die Sprache zu verwenden, rapide abnehmen.
 Karte der Region, in der Kera'a gesprochen wird
Karte der Region, in der Kera'a gesprochen wird
Kera'a hat zwei Hauptdialekte: Midu und Mithu. Während Midu von der Mehrheit der Kera'a gesprochen wird, ist Mithu die konservativere und weniger angesehene Variante. Neben diesen beiden Dialekten verwendet die Gemeinschaft auch die Sprache Igu, die von Schamanen bei schamanischen Ritualen verwendet wird.
Herausforderungen der Feldforschung
Die sprachwissenschaftliche Feldforschung in Kera'a birgt Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen. So ist beispielsweise der Zugang zu der Region für die Forschenden aufgrund der angespannten politischen Lage nur begrenzt möglich. Auch die Sprache selbst stellt eine Herausforderung dar. Kera'a ist eine tonale Sprache, und es kann für Sprecher*innen nicht-tonaler Sprachen schwierig sein, die feinen Unterschiede im Ton zu erkennen.
Die Hilfe von Kera'a-Sprecher*innen selbst ist besonders wichtig für das Verständnis der Sprachstruktur, da die Forschenden keine Mitglieder der Gemeinschaft sind. Doch selbst mit der Unterstützung der lokalen Bevölkerung haben einige der Probleme, auf die die Forschenden stoßen, keine einfachen Lösungen. Wie kann man eine Sprache analysieren, die man nicht kennt? Wie kann man eine Sprache transkribieren, die nicht verschriftlicht ist? Die Feldforschung bei den Kera'a ist daher mit viel Experimentieren und Lernen aus Fehlern verbunden.
Der Transkriptions- und Übersetzungsprozess
Eine Herausforderung besteht darin, wie der/die Berater*in die Aufgabe versteht und wie der/die Forschende die Daten interpretiert; der/die Forschende muss flexibel bleiben, aber auch kritisch mit dem Input umgehen, den er/sie erhält.
Natürliche Datenerhebung
Die Datenerhebung sollte idealerweise Aufnahmen einschließen, in denen die Sprache näher am natürlichen Sprachgebrauch ist. Um solche Daten zu erheben, kann man die Sprecher*innen bitten, eine Geschichte zu erzählen oder ein Gespräch zwischen zwei oder mehr Sprecher*innen aufnehmen.
Material über die Kera'a für die Kera'a
Das aufgezeichnete Material hat oft einen emotionalen Wert für die Mitglieder der Kera'a-Gemeinschaft. Ein Video mit Untertiteln kann den Kera'a helfen, miteinander in Kontakt zu treten und die Kluft zwischen älteren und jüngeren Generation, die vielleicht nicht mehr so fließend sprechen, zu überbrücken. Auf dem Bild unten sieht man Dr. Uta Reinöhl, die Mitgliedern der Kera'a-Gemeinschaft eine transkribierte und übersetzte Aufnahme eines Heilungsrituals zeigt.

Ergebnisse der Feldforschung
Man sollte die Forschenden nicht als reine Aktivisten betrachten - bei der Feldforschung geht es im Allgemeinen nicht darum, sich für die Gemeinschaft gegen die lokalen Gesetze einzusetzen. Was mit der Feldfroschung erreicht werden soll, hängt von der jeweiligen Sprache und den persönlichen Zielen der Forschenden ab. Die Feldforschung kann jedoch manchmal auch politisch werden, nämlich dann, wenn die Gemeinschaft die Forschenden ermächtigt, sie zu vertreten. Für das Projekt mit den Kera'a gehören zu den allgemeinen Zielen das Verständnis und die Dokumentation der Strukturen von Kera'a und Igu sowie die Erstellung wissenschaftlicher Ergebnisse in Form von Büchern und Zeitschriftenartikeln.
Die Feldforschung kann nur mit dem Einverständnis der Kera'a und unter Berücksichtigung ihrer Perspektiven und Wünsche erfolgen, da die Feldforschung ohne ihre Mitarbeit nicht möglich ist. Die Forschenden müssen auch entscheiden, welche Maßnahmen der Gemeinschaft zugute kommen und welche Ziele erreichbar sind - wie kann man den Kera'a helfen, ihre Sprache zu pflegen, ohne dabei voreingenommen zu sein?
Kinderbuch
Kinderbücher sind ein Beispiel dafür, wie sich die Kera‘a Gesellschaft für die Pflege ihrer Sprache unter jüngeren Sprecher*innen einsetzt.
Thũwe - Die Tracht der Kera'a
Wie die Sprache, wird auch die Thũwe heutzutage vor allem von der älteren Generation im Alltag getragen, während sich die junge Generation eher den globalen Trends anpasst.
Buch eines Kera'a Märchen
Die Dokumentation traditioneller Geschichten trägt dazu bei, eine Sprache lebendig zu erhalten. Die Kera‘a schätzen ihre Volksmärchen, die sie einander und ihren Kindern erzählen. Veröffentlichungen halten diese Geschichten am Leben, auch wenn sie aus der Alltagskultur verschwinden.
Forschungsnotizbuch
Neben Audio- und Videoaufnahmen, stützen sich Forscher*innen auch auf Notizen, die Beobachtungen zur Sprache oder zur Umgebung, in der etwas gesagt wird, umfassen können. Diese Notizen können später bei der Datenanalyse hilfreich sein, da sie es den Forscher*innen ermöglichen, frühere Eindrücke wieder aufzugreifen, sich an bestimmte Details eines Gesprächs zu erinnern, oder kontextbezogene Informationen abzurufen, die aus den Aufnahmen allein nicht unmittelbar ersichtlich sind.
Projektinformation
Mehr Information über die Projekt finden Sie hier.